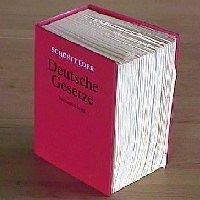
Voraussetzungen erfolgreicher und bewährter Politik: Integration-Prävention-Repression
Das Niedersächsische Handlungsprogramm
Ministerpräsident Christian Wulff äußert sich aus aktuellem Anlass vor dem Hintergrund des brutalen Überfalls von München zu den Themen Integration, Prävention und Repression.
Bei der Diskussion über die Gewalttat in München wird vielfach die Frage in den Mittelpunkt gerückt, welche Maßnahmen zur Bestrafung von Tätern notwendig und angemessen sind. Dabei dürfen neben der Erörterung von Maßnahmen der Repression auch bewährte Strategien der Prävention und Integration, die auf die Vermeidung von Straftaten gerichtet sind, nicht aus dem Auge verloren werden,
In Niedersachsen leben Menschen aus 195 Nationen, die mit ihrem Engagement, ihren Talenten und ihren Traditionen unser Leben bereichern und aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Die überwiegende Mehrheit dieser Menschen ist gut integriert und hat ihren Platz in der Gesellschaft gefunden.
Daneben gibt es aber auch Zugewanderte und nachgewachsene Generationen, die nicht integriert sind und in Parallelgesellschaften leben. Um die Abschottung und das Abgleiten von Zugewanderten in Kriminalität zu vermeiden, ist ein politisches Handlungsprogramm notwendig, in dem Maßnahmen der Integration, Prävention und Repression miteinander verzahnt sind. Innenminister Uwe Schünemann, Justizministerin Elisabeth Heister-Neumann, Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann und Kultusminister Bernd Busemann haben ein umfassendes Konzept mit fachlich aufeinander abgestimmten Maßnahmen entwickelt und in die Praxis umgesetzt.
Integration:
Die Integration von Zugewanderten, insbesondere von Kindern und Jugendlichen der zweiten und dritten Generation, ist in unserer Gesellschaft eine politische Schlüsselaufgabe. Wesentliches Element der Integrationspolitik ist der Grundsatz des Förderns und Forderns.
1. Grundwerteakzeptanz und Sprachkompetenz als Integrationsvoraussetzungen
Unabdingbare Voraussetzung für das Zusammenleben in unserem Land ist das Bekenntnis zu den Grundwerten, wie der Unantastbarkeit der Menschenwürde, der Einhaltung der Menschenrechte sowie das Bekenntnis zur freiheitlichen, demokratischen Grundordnung.
Integration erfordert die Bereitschaft zu Offenheit, Verständnis und Toleranz. Wer dauerhaft in Deutschland leben will, muss sich dazu bekennen, ohne seine Herkunft zu verleugnen oder seine Wurzeln aufzugeben. Integrationsverweigerung und der Entwicklung von Parallelgesellschaften muss daher entschieden entgegengetreten werden.
Wer unsere Rechtsordnung nicht akzeptiert und gegen Strafgesetze verstößt, hat in Deutschland keinen Platz. Aus diesem Grund wurde auf die Initiative Niedersachsens geregelt, dass eine Einbürgerung nur möglich ist, wenn keine bedeutsamen Straftaten begangen worden sind. Straftäter haben grundsätzlich das Recht verwirkt, unsere Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Durch eine Änderung des Aufenthaltsrechts muss sichergestellt werden, dass ausländische Straftäter bereits bei einer Haftstrafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung zwingend ausgewiesen werden, und nicht erst wie bislang unter bestimmten Voraussetzungen nach drei Jahren.
Notwendige Bedingung für eine gelingende Integration ist das Erlernen der deutschen Sprache, da nur der Erwerb von Sprachkenntnissen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Deshalb hat Niedersachsen auf Bundesebene durchgesetzt, dass die erfolgreiche Teilnahme an verpflichtenden Einbürgerungskursen, insbesondere der Nachweis hinreichender Kenntnisse der deutschen Sprache Voraussetzung für eine Einbürgerung ist.
Integrationspolitik bedeutet das Angebot von Integrationsmaßnahmen, insbesondere zur Sprachförderung, und die enge Verknüpfung mit Jugend-,Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik.
2. Erfolgreiche Integrationsmaßnahmen in Niedersachsen:
- Niedersachsen hat als erstes Bundesland ein Verfahren zur vorschulischen Sprachstandsfeststellung eingeführt und verpflichtend die Sprachförderung vor der Einschulung im Schulgesetz verankert.
- Die Hauptschule wurde gestärkt und profiliert durch die Einführung von Betriebs- und Praxistagen, die Erhöhung der Pflichtstundenzahl, die Bildung kleinerer Klassen, den Einsatz von Sozialarbeitern, zusätzlichen Ganztagsschulangeboten sowie die verstärkte Kooperation zwischen örtlichen Berufsschulen und Wirtschaftsbetrieben.
- Zur Senkung der Schulabbrecherquote wurde am 1.2.2007 in einer gemeinsamen Initiative des Landes und der Regionaldirektion Niedersachsen/Bremen der Agentur für Arbeit das Modellprojekt "Abschlussquote erhöhen, Berufsfähigkeit steigern" gestartet. Es unterstützt 500 Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen der Hauptschule durch individuelle Qualifizierung und Begleitung mit dem Ziel eines erfolgreichen Hauptschulabschlusses und eines Berufseinstiegs.
- In Berufseinstiegsklassen an berufsbildenden Schulen können Schüler einen fehlenden Hauptschulabschluss erwerben oder einen schlechten Hauptschulabschluss verbessern. Zugleich wird ihre Ausbildungsfähigkeit gesteigert.
- Seit dem Schuljahr 2005/2006 sind an allen berufsbildenden Schulen, die ein Berufsvorbereitungsjahr anbieten, sozialpädagogische Fachkräfte tätig.
- Seit dem Schuljahr 2003/2004 erhalten 1.300 Schüler an 26 Schulen im Rahmen eines Schulversuchs islamischen Religionsunterricht.
- Das Land hat mit der Regionaldirektion Niedersachsen/Bremen der Agentur für Arbeit Anfang 2007 einen Pakt für Ausbildung mit dem Ziel abgeschlossen, jedem ausbildungsfähigen und -willigen Jugendlichen ein Ausbildungsangebot unterbreiten zu können. Dieser Pakt sieht spezielle Maßnahmen für jugendliche Migrantinnen und Migranten vor.
- Niedersachsen fördert seit 2004 die von den Landkreisen und kreisfreien Städten eingerichteten Pro-Aktiv-Centren, in denen jungen Menschen mit Einglie-derungshemmnissen passgenaue Ausbildungs- oder Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten werden. Junge Migrantinnen und Migranten werden dabei mit ihrem besonderen Förderbedarf besonders berücksichtigt.
- Das Land fördert ambulante sozialpädagogische Angebote der Jugendhilfe für junge Straffällige, die soziale Gruppenarbeit, Einzelbetreuung, Täter-Opfer-Ausgleich und sozialpädagogisch betreute Arbeitsleistungen umfassen.
- Das Land unterstützt die Kommunen mit der Einrichtung von 15 Leitstellen für Integration und fördert an 80 Standorten die –inzwischen erfolgreich abgeschlossene- Ausbildung von 900 ehrenamtlichen Integrationslotsen, die Zugewanderte bei der sprachlichen, schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Integration begleiten.
- Niedersachsen hat im Jahr 2007 26 Migrantinnen und Migranten in den Polizeidienst aufgenommen. Insgesamt gibt es bereits über 300 Beschäftigte mit Migrationshintergrund in der niedersächsischen Polizei.
- Das Land fördert das Programm "Integration durch den Sport" des Deutschen Sportbundes, mit dem die integrative Arbeit der Sportvereine mit Zuwanderern und Spätaussiedlern unterstützt wird.
- Im Innenministerium wurde eine Integrationsbeauftragte eingesetzt, die sich ressortübergreifend mit integrationspolitischen Maßnahmen befasst und den Dialog mit Migrantinnen und Migranten und der Öffentlichkeit führt.
Prävention:
Neben der Integration ist die Gewaltprävention von herausragender Bedeutung, um Straftaten bereits im Vorfeld zu verhindern. Dies gilt unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Aus diesem Grund ist Prävention der beste Opferschutz.
In Niedersachsen sind auch in diesem Bereich frühzeitig die notwendigen Maßnahmen ergriffen worden:
- Der Landespräventionsrat, dessen Geschäftsstelle im Niedersächsischen Justizministerium angesiedelt ist, vernetzt kommunale Präventionsgremien und weitere Institutionen sind und fördert damit einen flächendeckenden Austausch der gesellschaftlichen Gruppen. Zu den besonderen Schwerpunkten der Arbeit des Landespräventionsrates gehört die Prävention von Jugendkriminalität.
- In 171 Kommunen Niedersachsens sind kommunale Präventionsräte entstanden, die sich mit Fragen der Sicherheit vor Ort und mit lokalen Strategien zur Kriminalitätsvermeidung beschäftigen. Diese Präventionsräte stellen ein trägfähiges und bewährtes Netzwerk für präventive Programme und Projekt dar.
- Im Jahre 2007 hat die Landesregierung in Niedersachsen flächendeckend das sogenannte "vorrangige Jugendverfahren" eingeführt, mit dem eine vorrangige Bearbeitung von Jugendstraftaten und damit eine besonders schnelle Reaktion auf das begangene Unrecht ermöglicht wird. Damit ist sichergestellt, dass auf jugendliches Fehlverhalten eine staatliche Reaktion auf dem Fuße folgt und eine größtmögliche erzieherische Wirkung erzielt wird.
- In den niedersächsischen Polizeiinspektionen sind Präventionsteams eingerichtet worden, die vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von Jugendgewalt treffen. Zudem wurden Spezialisten in der Bearbeitung von Jugendsachen in speziellen Fachkommissariaten und Arbeitsfeldern der Dienststellen konzentriert.
- Die Zusammenarbeit von Schulen, Polizei und Staatsanwaltschaften wurde mit gemeinsamen Regelungen deutlich intensiviert, so dass ein schnellerer und effektiverer Informationsaustausch und eine verbesserte Kooperation möglich ist.
Repression:
Bei allem Bemühen um die Prävention von Straftaten ist ein schnelles, entschlossenes und effektives Einschreiten zur Ahndung begangenen Unrechts erforderlich. Die Landesregierung verfolgt dabei im Bereich der Jugendkriminalität das Ziel, Straftaten konsequent zu ahnden und den Jugendlichen zugleich Zukunftschancen zu eröffnen. Notwendig ist die Verbindung von konsequenten Strafen und der Gewährung von Förderangeboten.
1. Gesetzentwurf Niedersachsens zur verbesserten Bekämpfung der Jugendkriminalität
Ein konsequenter Umgang mit Jugendkriminalität setzt voraus, dass strafrechtliche Sanktionen für jugendliche Täter spürbar sind, damit Rückfälle vermieden und Wege zu einem rechtstreuen Leben aufgezeigt werden. Aus diesem Grund müssen im Jugendstrafrecht präventive Maßnahmen verstärkt und das rechtliche Handlungsinstrumentarium erweitert werden.
Die Landesregierung hat bereits im Jahr 2003 gemeinsam mit den Ländern Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen einen Gesetzentwurf zur Verbesserung der Bekämpfung der Jugenddelinquenz in den Bundesrat eingebracht, der nach Beschluss des Bundesrates am 20.6.2003 dem Bundestag übermittelt wurde. Eine Verabschiedung scheiterte an den Stimmen der damaligen rot-grünen Regierungskoalition. Am 23.3.2006 hat der Bundesrat mit der Unterstützung Niedersachsens die Wiedereinbringung des Gesetzentwurfes in den Bundestag beschlossen. Eine Mehrheit für den Gesetzentwurf im Bundestag kommt bislang wegen der Verweigerungshaltung der SPD-Bundestagsfraktion und Bundesjustizministerin Zypries nicht zustande.
Der Gesetzentwurf sieht folgende Neuregelungen vor:
- Einführung eines Warnschussarrests, der neben einer zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe verhängt werden kann, um dem jugendlichen Täter den Ernst der Lage vor Augen zu führen.
- Die Anwendung des Erwachsenenstrafrechts soll für Täter ab einem Alter von 18 Jahren bis zur Vollendung des 21 Lebensjahres zum Regelfall und das Jugendstrafrecht zur Ausnahme gemacht werden.
- Gegen Heranwachsende, auf die wegen ihrer mangelnden Reife noch Jugendstrafrecht anzuwenden ist, soll für schwere Verbrechen eine Jugendstrafe von bis zu 15 Jahren statt maximal 10 Jahren verhängt werden können. Bei schweren Taten ist das bisherige Höchstmaß der Jugendstrafe von 10 Jahren als unangemessen anzusehen.
- Einführung des Fahrverbotes oder die Verhinderung des Erwerbs eines Führerscheins als eigenständige Sanktion im Jugendstrafrecht und die Erweiterung des Anwendungsbereichs auch außerhalb von Verkehrsstraftaten.
2. Mehr Sicherheit und Opferschutz durch das Niedersächsische Justizvollzugsgesetz
Am 1. Januar 2008 ist das Niedersächsische Justizvollzugsgesetz in Kraft getreten, in dembundesweit erstmals der Vollzug der Freiheitsstrafe an Erwachsenen und der Vollzug derJugendstrafe sowie Untersuchungshaft und Sicherungsverwahrung in einem Gesetz geregeltsind. Mit dem Gesetz wird den Besonderheiten des Jugendvollzugs Rechnung getragen undsichergestellt, dass Jugendliche nicht einfach "weggesperrt" werden. Vielmehr steht der der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Dies zeigt auch der Vorrang von Ausbildung imStrafvollzug, um den Jugendlichen über die Chance einer Ausbildung positive Zukunftsperspektiven zu ermöglichen, die Eigenverantwortung zu stärken und ein sozial angemessenes Verhalten zu fördern.
Bei der Diskussion über die Notwendigkeit sogenannter Erziehungscamps ist daher zuberücksichtigen, dass moderne Strafvollzugsanstalten mit dem auf Erziehung undFörderung ausgerichteter Jugendstrafrecht bereits die Funktion von Erziehungseinrichtungen erfüllen.
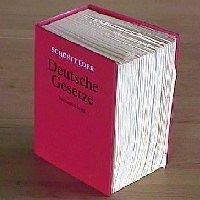
Deutsche Gesetze
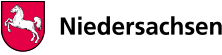

 english
english français
français español
español nederlands
nederlands plattdüütsch
plattdüütsch русский
русский polski
polski 中文
中文 日本語
日本語